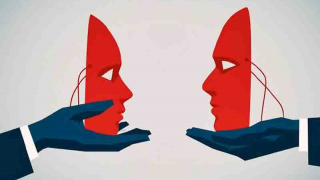Warum strebt das Kapital danach, die Schule zu zerstören?
Die neoliberale Pädagogik degradiert die Schule als ein Unternehmen, das Fähigkeiten für das Funktionieren des Systems produzieren soll. Daher feiert sie die Speicherung von Fähigkeiten und das Primat des Tuns: und löst jede Wissensfigur auf, die nicht mit dem Pragmatismus der Effizienz verbunden ist.
So triumphiert am gesamten Horizont das, was man nur als "barbarische Kultur" bezeichnen kann, um Veblens Bild in Die Theorie der müßigen Klasse zu entlehnen: eine Kultur also, die nicht nur die Emanzipation der Gesellschaft nicht fördert, sondern sie in die entgegengesetzte Richtung drängt, indem sie jeden möglichen Wunsch unterdrückt, dem Stahlkäfig der auf Waren reduzierten Welt zu entkommen. Die alten Regime haben Bücher verbrannt: das aktuelle Regime macht die Figur des Lesers in Form von Waren strukturell unmöglich.
Im Triumph des esprit de quantité über den esprit de finesse kann das Kapital die Existenz autonom denkender Köpfe, gebildeter Subjekte mit kultureller Identität und kritischer Tiefe, die sich ihrer Wurzeln und der Falschheit der Gegenwart bewusst sind, nicht akzeptieren. Mit anderen Worten, es kann das frühere bürgerliche Profil des gebildeten Menschen, der in seiner historischen Kultur verwurzelt und in der Planung offen für die Zukunft ist, nicht akzeptieren.
Stattdessen strebt sie danach, überall dasselbe zu sehen, nämlich Konsumatome ohne Identität und Kultur, rein berechnende und unreflektierte Köpfe, die nur das Englisch der Märkte und der Finanzen sprechen und unfähig sind, den techno-ökonomischen Apparat in seiner ausdrucksstarken Totalität in Frage zu stellen.

In diesen kognitiven Rahmen muss auch das Phänomen der so genannten "digitalen Universitäten" eingeordnet werden, die ihren Studenten Fernstudiengänge und Abschlüsse anbieten, die sie erwerben, ohne jemals einen Fuß in die konkreten Räume der Universität als Ort der Diskussion und des Vergleichs, des Dialogs und der Ausübung von Kritik gesetzt zu haben.
Unter diesem Gesichtspunkt begünstigt die neue digitale Gestalt Prozesse der Massenindividualisierung, indem sie das Element der menschlichen Konfrontation und der Konzentration der Studenten an denselben Orten neutralisiert und im Großen und Ganzen das Wissen zunehmend auf vorgefertigte Module reduziert, die aus der Ferne verwaltet werden, ohne jegliche menschliche Beziehung zum Lehrer.

Dies wurde u.a. von Veen und Vrakking in ihrer Studie Homo zappiens theoretisiert: Ihr theoretischer Vorschlag konzentriert sich auf die Idee, mit den traditionellen und ihrer Meinung nach veralteten pädagogischen Formen zu brechen und die Unterrichtsorte an die Bedürfnisse der Netzgeneration anzupassen. Das Internet und sein Modell müssen also den klassischen Frontalunterricht ersetzen, mit dem der Westen von der griechischen Zeit bis zum Mittelalter, von der Renaissance bis zum 20. Jahrhundert.
In den letzten zwanzig Jahren sind die Schulen in Europa einer radikalen Dynamik der Korporatisierung unterworfen worden, die sie in kürzester Zeit in ihren Grundfesten umgestaltet hat.
Von einer Einrichtung zur Bildung von Menschen im vollen Sinne, die sich ihrer historischen Welt und ihrer Geschichte bewusst sind, hat sie sich in ein Unternehmen verwandelt, das Fähigkeiten und Kompetenzen vermittelt, die untrennbar mit dem utilitaristischen Dogma verbunden sind, "einem Zweck zu dienen".
In diesem Zusammenhang ist das Phänomen der "Studentenverschuldung", das die liberalen amerikanischen Universitätscampus kennzeichnet, und die totale Privatisierung der Kultur von Bedeutung. Öffentliche und private Universitäten erhöhen ständig die Studiengebühren und zwingen die Studenten, sich zu verschulden, um Zugang zu ihnen zu erhalten. Auf diese Weise werden die Universitäten nicht nur in Vorposten der Wertverwertung und Profitfabriken verwandelt und von dem in Lockes Zweiter Abhandlung über die Regierung gefeierten Wunsch, mehr zu haben, angetrieben, sondern die Studenten selbst werden zu Gefangenen der Mechanismen der Schuldenmacherei. Sie werden schon in jungen Jahren zu Sklaven einer Schuld, die sie für den Rest ihres Lebens (meist erfolglos) abzutragen versuchen werden.

Im Übergang von der platonischen Akademie und dem aristotelischen Lyzeum zu den Business Schools könnte man schließlich das Gleichnis des Westens diagnostizieren, der dem pathologischen "utilitaristischen Panökonomismus" von Latouche ausgeliefert ist.
Von einer Bildung, die im klassischen Sinne als umfassende und vielschichtige Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit verstanden wird, sind wir mühelos zu einer Ausbildung als intensive Anhäufung technischer und praktischer Fähigkeiten übergegangen, die für die Eingliederung in den instabilen, flexiblen und prekären Arbeitsmarkt funktional sind.
Dies führt zu einer Perversion des klassischen Konzepts der Schule als einem Ort, an dem die Zeit aus den Fängen des Profits genommen und dem Lernen gewidmet wird, das auf die Bildung der eigenen Persönlichkeit abzielt.
In diesem Zusammenhang ist es nützlich, sich daran zu erinnern, dass in den europäischen Sprachen "Schule" (school, school, école) die Institution der Grundausbildung junger Menschen genannt wird, mit einem direkten Verweis auf das σχολή der Griechen, d.h. die freie Zeit, die die Römer als otium definieren würden, und otium ist seinem Wesen nach das Gegenteil von negotium, das die Zeit ist, die vom Geschäft im Namen des Profits in Anspruch genommen wird. Das Paradoxe an der Schule in der Ära des post-bürgerlichen Kapitalismus ist, dass sie immer offener zum Prinzip des negotium übergeht, zu einer Institution der Vorbereitung auf die Arbeitspraxis wird und damit ihr eigenes Wesen des otium verleugnet.
Auch für die schulische und universitäre Bildung gilt die allgemeine Regel des flexiblen und prekären chrematistischen Systems: Die Korporatisierung der Lebenswelt schreitet gleichzeitig mit der Entetisierung der Lebenswelt voran. Die integrale Kommodifizierung basiert auf der Zerstörung der früheren ethischen Zwänge der bürgerlichen Phase und dem Höhepunkt des konsumistischen Individualismus.
Die Einführung der liberalen Rationalität in die tiefste Struktur der Persönlichkeit bestimmt die integrale Besetzung des Materiellen und Immateriellen durch die Warenform und das ihr entsprechende kalkulatorische und ökonomische Modell: Dieses Paradigma durchdringt das Ich, aber auch das Ego, die magmatische und schwer fassbare Sphäre der Instinkte und Triebe, es verschont auch das Über-Ich nicht und dringt sogar in den Bereich der moralischen und religiösen Fragen ein. Hierin liegt das, was man die "Neoliberalisierung der Subjekte" genannt hat.
Die Zerstörung der Ethik und ihrer Wurzeln schreitet zusammen mit der Wiederbesetzung ihrer Räume durch das System der Bedürfnisse und die Warenform voran. Dies zeigt sich nicht nur in der unternehmerischen Neudefinition der öffentlichen Schulen im Rahmen der neoliberalen Ordnung, sondern auch in der Privatisierung anderer grundlegender ethischer Einrichtungen wie dem Gefängnis- und Krankenhauswesen.
Was den ersteren betrifft, so steht die Dollarmonarchie auch in diesem Fall an der Spitze des Postmodernisierungsprozesses: Die Privatisierung des Gefängnissystems in diesem Land setzt die Gefangenen einer lästigen Kontrolle aus, die sich oft deutlich von der gesetzlichen und politischen Regelung entfernt.
Brutale Schläge und sichtbare Unterernährung sind die Regel und in ihrer Gesamtheit die notwendige Umsetzung des Prinzips, dass Geschäft Geschäft ist: Nach diesem Prinzip wird der Gefangene nicht mehr als Person verstanden, die umerzogen und rehabilitiert werden muss, um wieder in die Zivilgesellschaft eingegliedert zu werden, sondern als Ressource, aus der ein Mehrwert gewonnen werden soll.
Dies führt zu einer krampfhaften Suche nach immer neuen "Ressourcen", die interniert werden müssen (damit es keine leeren Plätze mehr gibt), und somit zu einer neuen repressiven Politik auch in Bezug auf so genannte "geringfügige Vergehen".
Was den Gesundheitssektor betrifft, so fördert das liberale Regime nach seinem eigenen Bild eine immer stärkere "Kommodifizierung" von Gesundheit und Leben. Dies ermöglicht die Behauptung, dass die Gesundheitsfürsorge zutiefst krank ist: Die Fürsorge in ihrem spezifisch wissenschaftlichen (die Ausrottung von Krankheiten) und humanistischen ("Fürsorge" als grundlegende existenzielle Modalität, wie sie von Sein und Zeit vorgeschlagen wird) Sinn wird durch die unternehmerische Figur des Profits als letztem Ziel des Handelns ersetzt.
Die liberale Neudefinition des medizinischen Paradigmas hat katastrophale und höchst widersprüchliche Auswirkungen, die letztlich darauf beruhen, dass die Gesundheit (wiederum in Anlehnung an das US-Modell) von einem Bürgerrecht zu einer Konsumware umgestaltet wird. Zu den bedauerlichsten Auswirkungen gehört der drastische Abbau von medizinischem und pflegerischem Personal mit einer damit verbundenen Verlangsamung der Interventionszeiten und einem erhöhten Sterberisiko für die Patienten, die inzwischen zu "Konsumenten" geworden sind. Es darf auch nicht übersehen werden, dass die Mittel für Krankheiten wie Krebs und die beträchtliche Kürzung der Pflege für Behinderte und psychisch Kranke immer weiter gekürzt werden.
Im zweiten Kontext wird dies durch das Auftauchen der neuen Figur des "Gesundheitsunternehmens" unterstützt, das an die Stelle der früheren öffentlichen "Krankenhäuser" getreten ist: Das allgemein anerkannte Recht auf Gesundheitsversorgung für jeden Bürger wird zu einer Ware, die je nach Tauschwert erhältlich ist, was zu einem exponentiellen Wachstum sowohl des Luxussektors der kosmetischen Chirurgie für einige wenige als auch der Unmöglichkeit des Zugangs zu grundlegenden Behandlungen für viele führt.
Diego Fusaro
Diego Fusaro (Turin, 1983) ist Professor für Philosophiegeschichte am IASSP in Mailand (Institute for Advanced Strategic and Political Studies), wo er auch wissenschaftlicher Direktor ist. Er promovierte in Geschichtsphilosophie an der Vita-Salute San Raffaele Universität in Mailand. Fusaro ist ein Schüler des italienischen marxistischen Denkers Costanzo Preve und des berühmten Gianni Vattimo. Er ist ein Wissenschaftler der Geschichtsphilosophie, der sich auf das Denken von Fichte, Hegel und Marx spezialisiert hat. Sein Interesse gilt dem deutschen Idealismus, seinen Vorläufern (Spinoza) und seinen Nachfolgern (Marx), mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem italienischen Denken (u.a. Gramsci oder Gentile). Er ist Leitartikler für La Stampa und Il Fatto Quotidiano. Er bezeichnet sich selbst als "unabhängiger Jünger von Hegel und Marx".
Quelle: http://adaraga.com/por-que-el-capital-aspira-a-destruir-la-escuela/
Übersetzung von Robert Steuckers: https://synergon-info.blogspot.com/2023/04/warum-strebt-das-kapital-danach-die.html