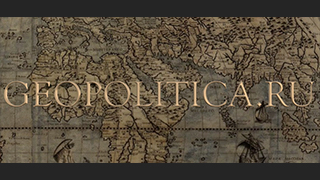Wirtschaftssanktionen: ein britischer Algorithmus für die Pax Americana
Sanktionen als ein Mechanismus verschiedener Restriktionen sind seit vielen Jahren Gegenstand von Forschungen und lebhaften Diskussionen. Zweifellos haben die beispiellosen Maßnahmen der westlichen Länder gegen Russland und die darauf folgende Kettenreaktion, die über die ganze Welt hinwegging, das Interesse an diesem Thema erhöht. Doch wie die Arbeiten von Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern zeigen, haben Sanktionen als solche nie die Wirkung gehabt, für die sie eingeführt wurden. Sie sind schädlich, sinnlos und bestrafen oft genau die Staaten, deren Regierungen sie verhängt haben, nach dem Bumerang-Prinzip. Außerdem haben die westlichen Länder anfangs falsche Wahrnehmungen benutzt, um Sanktionen zu rechtfertigen.
Die Geschichte der Sanktionen wird in der Regel bis zur antiken griechischen Polis und dem Beispiel des Vorgehens Athens gegen Megara zurückverfolgt, als dessen Kaufleuten verboten wurde, die Häfen der von Athen geführten Seefahrtsunion zu benutzen. Daraufhin warfen Megara und Korinth im Rat des Peloponnesischen Bundes Athen feindliche Handlungen vor und schließlich brach der dreißigjährige Peloponnesische Krieg aus, in dem Athen gegen Sparta verlor.
Im Westen werden die Handelsbeschränkungen jedoch als demokratische Maßnahmen interpretiert, die sich auf die historische athenische Demokratie beziehen. Dabei vergessen die Befürworter von Sanktionen, entweder aus Unwissenheit oder absichtlich, zu erwähnen, dass die athenische Demokratie ganz anders war als die liberale Demokratie in der modernen Welt - dort waren Frauen nicht an Entscheidungen beteiligt, hatten einfach kein Wahlrecht und die athenische Demokratie war ein Sklavensystem. Es ist kein Zufall, dass Platon die Demokratie als eine der schlimmsten Regierungsformen nach der Timokratie, d.h. der Herrschaft der Kapitalisten, bezeichnete. Auch hier führte das Ergebnis der athenischen Sanktionen zu einem verheerenden Krieg in der Region und dem Untergang Athens selbst. Und die heutigen liberalen Demokraten sind sich dieser Tatsache einfach nicht bewusst.
Und schließlich: Wenn sich die westlichen Länder regelmäßig auf das Christentum als ihr eigenes Erbe berufen, warum vergessen sie dann eines der Gebote Christi: "Was ihr wollt, das man euch tut, das tut auch den anderen"? Die Antwort liegt in der Heuchelei und Doppelmoral der westlichen Politiker.
Natürlich gab es im Mittelalter und in der Neuzeit auch andere Formen von Sanktionen. Die Exkommunikation durch die katholische Kirche wird ebenfalls oft als eine Art von Sanktion angesehen. Aber auch hier können wir den gegenteiligen Effekt sehen - zum einen durch die Einführung des Ablasshandels und zum anderen durch das Aufkommen von Reformisten und die Entstehung verschiedener protestantischer Sekten, die die Hegemonie des Vatikans in Europa zerstörten.
Was den Zeitraum der letzten 50 Jahre betrifft, so gibt es keine eindeutig positive Antwort auf die Frage nach den Auswirkungen der Sanktionen auf ihre Initiatoren.
In einem Artikel werden beispielsweise die Auswirkungen der von den USA verhängten Sanktionen auf die bürgerlichen Freiheiten der Zielländer für den Zeitraum 1972-2014 untersucht [i]. Um dieses Problem zu lösen, verwenden die Autoren eine potenzielle Ergebnisstruktur, die unabhängig von der Wahl der Matching-Variablen ist und den zusätzlichen Vorteil hat, dass sie die Auswirkungen auf die Ergebnisvariable im Laufe der Zeit aufzeigt. Sie stellen fest, dass Sanktionen zu einer Abnahme der bürgerlichen Freiheiten führen, die entweder mit dem Freedom House Civil Liberties Index oder dem Cinranelli and Richards Empowerment Index gemessen werden. Sie stellen fest, dass die Ergebnisse robust gegenüber verschiedenen Spezifikationen sind. Das heißt, die Wirkung der Sanktionen war das Gegenteil des erwarteten Ergebnisses, denn eines der Gebote der US-Außenpolitik, einschließlich restriktiver Maßnahmen, ist die Verbreitung und Stärkung der bürgerlichen Freiheiten.
Auch aus der Forschung können wir schließen, dass es die angelsächsischen Länder sind, d.h. die USA und Großbritannien, die traditionell eine Sanktionspolitik verfolgen.
Es ist bekannt, dass Großbritannien innerhalb der EU traditionell ein Befürworter des Instruments der restriktiven Maßnahmen ist, dass es für die Einführung der meisten Sanktionsregelungen verantwortlich ist und dass es ein starker Befürworter von individuellen Einschränkungen ist. Die Rolle Großbritanniens bei den EU-Sanktionsregelungen seit 1991 ist gut dokumentiert [ii]. Als Großbritannien 2001 Restriktionen gegen Simbabwe verhängte, wurde das Sanktionsregime schnell von der gesamten EU übernommen, die es über ein Jahrzehnt lang unterstützt hatte.
Eine Reihe von Politikern in der EU deutete nach dem Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der Gemeinschaft sogar an, dass der Vorstoß für Sanktionen an Schwung verlieren würde. In der Tat war ein Rückgang des innereuropäischen Zusammenhalts bei den Sanktionen gegen Russland zu beobachten. Insbesondere Ungarn hat diesen Ansatz aktiv kritisiert. Was den europäischen Ansatz anbelangt, so war er in der Vergangenheit entweder eine Reaktion auf die Aktionen Großbritanniens oder der USA, oder er folgte der von diesen festgelegten Politik. Außerdem verfügt die EU über kein Instrument zur Durchsetzung von Sanktionen, das mit dem der USA vergleichbar wäre. Die EU-Institutionen haben im Allgemeinen kein Mandat zur Überwachung der Auswirkungen von EU-Sanktionen, das über die Zuständigkeiten der jeweiligen Verantwortlichen und geografischen Arbeitsgruppen hinausgeht [iii].
Es gibt keinerlei vereinbarte Indikatoren für eine solche Überwachung, und die Bewertungen wurden bisher auf Ad-hoc-Basis durchgeführt. Als ein hochrangiger EU-Beamter 2006 während einer Anhörung im britischen Oberhaus zu den Auswirkungen der EU-Sanktionen auf Myanmar befragt wurde, gab er zu, dass es zwar "einige unbeabsichtigte und zufällige ... Kollateralfolgen für die Bevölkerung geben kann", aber "[sie] haben nicht erkannt, dass dies ein ernstes Problem ist" [iv].
Trotz der Schwierigkeiten, die Wirksamkeit von Sanktionen zu messen, hat man dennoch versucht, ihren Erfolg zu bewerten. Verschiedene Analysen haben ergeben, dass die Erfolgsquoten mit denen anderer Akteure, die Sanktionen verhängen, vergleichbar sind und tendenziell niedrig sind. Sie liegen zwischen 10 und 30 Prozent der Gesamtzahl der Versuche [v].
Eine vergleichende Bewertung hat jedoch gezeigt, dass EU-Sanktionen im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik tendenziell weniger erfolgreich sind als die Aussetzung der Hilfe im Rahmen der EU-Entwicklungspolitik [vi].
Es muss anerkannt werden, dass die Blütezeit der Sanktionsregime nach 1991 stattfand, als der unipolare Moment der Pax Americana etabliert wurde.
Der britische Autor Chris Doyle stellt in diesem Zusammenhang fest, dass "die verheerendsten von der UNO verhängten Sanktionen erst mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion möglich wurden, als die USA zum alleinigen Welthegemon wurden. Die UN-Sanktionen wurden plötzlich drastisch verschärft. Die Sanktionen, die von 1990 bis 2003 gegen den Irak verhängt wurden, waren die härtesten, die jemals gegen einen Nationalstaat verhängt wurden. Sie zerstörten die gesamte DNA der irakischen Gesellschaft. Andere Sanktionsregelungen gegen den Iran und Libyen hatten kontroverse Auswirkungen. Vierzig Jahre US-Sanktionen haben das Regime in Teheran kaum bewegt. Ist der Iran dem Atomabkommen von 2015 beigetreten, weil er eine Lockerung der Sanktionen wünschte? Das ist zweifelhaft. Was haben 60 Jahre US-Embargos gegen Kuba bewirkt? Die kubanische Wirtschaft ist zusammengebrochen, die Armut hat sich ausgebreitet, aber es gab keinen Regimewechsel. Nordkorea wurde strengen Sanktionen unterworfen, die keinerlei politische Auswirkungen hatten. [vii].
An dieser Stelle sollte hinzugefügt werden, dass die USA in dieser Zeit die UNO aktiv als Instrument ihrer eigenen Politik nutzten und über den kontrollierten IWF Druck ausübten. Wenn sich ein Land nicht der US-Position anschloss, wurde ihm einfach ein günstiges Darlehen oder ein Kredit verweigert.
Offensichtlich zwingen Sanktionen Länder dazu, ihre Außenpolitik anzupassen und andere Länder, die Opfer derselben Sanktionen geworden sind, als Partner zu betrachten. Syrien hat sich dem Iran und Russland angenähert. Chinesische Kreditgeber haben russischen Banken nach der Verhängung der westlichen Sanktionen Milliarden von Dollar geliehen. Russland beginnt, den Yuan als Reservewährung zu verwenden, um sich aus der Abhängigkeit vom Dollar und Euro zu lösen.
Die antirussischen Sanktionen und Beschränkungen haben sich als unwirksam erwiesen. Mehr noch: Während die US-Wirtschaft praktisch stagniert und die US-Geldwerte nicht mehr so stabil sind (Liquiditätsrisiken und überschüssige Barmittel), ist es Russland gelungen, seine Goldreserven zu erhöhen und zusammen mit der Volksrepublik China seine nationalen Währungen aus der "Risikozone" des Dollars herauszunehmen. [viii].
Im Jahr 2021 stellte das Centre for a New American Security in einem Sonderbericht über die Zusammenarbeit zwischen Russland und China fest, dass "Moskau und Peking bereits zusammenarbeiten, um US-Sanktionen und Exportkontrollen zu umgehen und so die Auswirkungen des wirtschaftlichen Drucks der USA zu mildern. Wenn sich ihre Partnerschaft vertieft oder wenn jedes Land für sich eine Resistenz gegen den Druck der USA aufbaut, könnte dies die Wirksamkeit der finanziellen Zwangsinstrumente der USA schwächen, insbesondere die Sanktionen und Exportkontrollen, die ein wichtiger Teil des außenpolitischen Arsenals der USA sind. Die Vereinigten Staaten wären weniger in der Lage, solche finanziellen Maßnahmen zu nutzen, um unerwünschtes Verhalten zu isolieren und abzuschrecken - nicht nur in Bezug auf China und Russland, sondern auch in Bezug auf andere Länder, die ihre Netzwerke anzapfen könnten, um den Druck der USA zu umgehen. Wenn sich zum Beispiel ihre Bemühungen um den Dollarabbau beschleunigen, würde dies die Fähigkeit Washingtons schwächen, Sanktionen auf der ganzen Welt durchzusetzen und den Kampf der USA gegen Korruption, Geldwäsche und andere Bemühungen, die das globale System stärken, beeinträchtigen [ix].
In der Tat haben die USA selbst damit begonnen, ihr "regelbasiertes" System zu zerstören, und es ist unwahrscheinlich, dass sie diesen Prozess aufhalten können, da sich immer mehr Länder in Richtung Multipolarität bewegen.
Derzeit gibt es eine Kampagne zur Delegitimierung der Anwendung einseitiger Sanktionen in UN-Foren. Neben der klassischen Resolution der UN-Generalversammlung, die ein Ende des Embargos gegen Kuba fordert, hat in letzter Zeit eine Kampagne im UN-Menschenrechtsrat an Fahrt gewonnen, die einseitige Sanktionen als menschenrechtswidrig verurteilt. Dies gipfelte in der Ernennung eines Sonderberichterstatters über die negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die Ausübung der Menschenrechte durch den Menschenrechtsrat im Jahr 2015 [x].
Dieser Trend hält an, wie in den Reden auf der letzten UN-Generalversammlung im September 2023 deutlich wurde. Auch die Verhängung unilateraler Sanktionen zusätzlich zu den Maßnahmen des UN-Sicherheitsrats ist auf einigen Widerstand gestoßen. China und Russland haben in diesem Monat das Sanktionsregime gegen die DVRK weitgehend aufgegeben und damit ihre zuvor im UN-Sicherheitsrat vertretene Position ins Gegenteil verkehrt. Es werden neue Mechanismen für internationale Abrechnungen geschmiedet, die das westliche Transaktionssystem umgehen. Ein Teil des Weges zur Überwindung der sinnlosen Restriktionen der USA und ihrer Satelliten ist geschafft. Was bleibt, ist, einige Fragen in der Praxis abzuschließen, um endlich den negativen Einfluss des kollektiven Westens zu überwinden und andere Länder dabei zu unterstützen, ihre eigene Souveränität und unser gemeinsames Wohl zu stärken.
Fussnoten:
i - Antonis Adam & Sofia Tsarsitalidou. Führen Sanktionen zu einem Rückgang der bürgerlichen Freiheiten? Public Choice, Band 180, Seiten 191-215 (2019).
ii - Jerg Gutmann, Matthias Neuenkirch, Florian Neumeier. The Economic Effects of International Sanctions: An Event Study. CESifo Working Paper Nr. 9007. 16 Apr 2021. papers.ssrn.com.
iii - Vries, A. de, Portela, C. & Guijarro, B., 'Improving the effectiveness of sanctions: A checklist for the EU', CEPS special report, no 95, Centre for European Policy Studies, Brüssel, 2014.
iv - UK House of Lords, Select Committee on Economic Affairs, Antwort des stellvertretenden Direktors der GD Außenbeziehungen, Europäische Kommission, Herrn Karel Kovanda, auf Q268, 17. Oktober 2006, publications.parliament.uk
v - Brzoska, M., 'Research on the effectiveness of international sanctions', in H. Hegemann, R. Heller & M. Kahl eds. Kahl (Hrsg.), Studying 'effectiveness' in International Relations, Budrich, Opladen, 2013, S. 143-160.
vi - Portela, C., 'A blacklist is born: Building a resilient EU human rights sanctions regime', EUISS Brief, no. 5, März 2020, www.iss.europa.eu
vii - www.arabnews.com
viii - Eugene Alexander Vertlieb. Projekt Putin-2024 in der Geostrategie der Konfrontation und internen Herausforderungen. Global Security and Intelligence Studies, Band 6, Nummer 2, Winter 2021. P. 189.
ix - Andrea Kendall-Taylor und David Shullman, Navigating the Deepening Russia-China Partnership. CNAS, 2021. P. 2.
x - Jiménez, F., 'Medidas restrictivas en la Unión Europea: Entre las 'sanciones' y el unilateralismo europeo' in C. Martínez & E. Martínez eds., Nuevos Retos para la Acción Exterior Europea, Valencia, 2017, pp. 509-534.
Übersetzung von Robert Steuckers