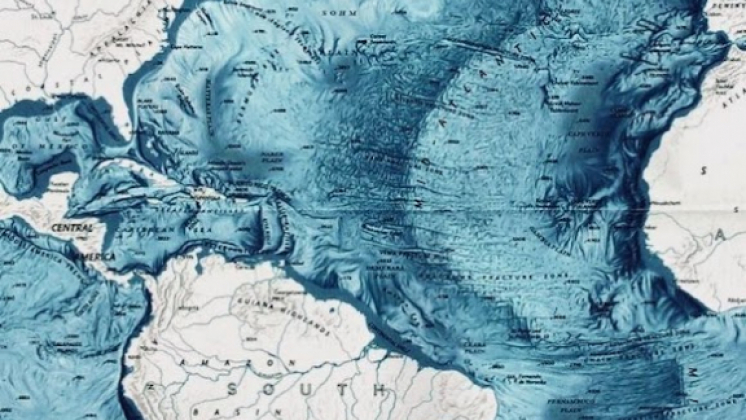Das Elend des Atlantismus
Da der größte Konsument von schwarzer-Legende-Produkten offenbar mit Abstand das spanische Publikum ist, sollte es nicht überraschen, dass die berühmte Bemerkung von Arturo Pérez-Reverte – der zufolge die Spanier in Trient den falschen Gott gewählt hätten – sich in bestimmten Kreisen, die Roger Scruton als „Oikophobe“ (die das eigene Erbe und Zuhause ablehnen)¹ bezeichnete, rasch zu einer Art Glaubensdogma entwickelt hat.
Dennoch bleibt es erstaunlich, wie sehr eine Mischung aus intellektueller Trägheit und Leichtgläubigkeit bei jenen zu beobachten ist, die die Behauptung des Romanciers und Akademikers übernehmen, dass Spanien in Trient einen autoritären und rückständigen Gott gewählt habe anstelle eines progressiven Gottes wie im Norden Europas, und dass diese Wahl uns in Unterwerfung, Rückständigkeit, Analphabetismus und Repression geführt habe.
Tatsächlich ist es so, dass, während in Holland und England Techniker, Finanziers und Kaufleute florierten, Spanien in seiner goldenen Epoche (also nach 1492) eine bemerkenswerte Zahl von Akademikern hatte, dank des Aufschwungs der Universitäten und Kollegien im 15. und 16. Jahrhundert, was zu einer bemerkenswerten Entwicklung der Theorien des internationalen und Handelsrechts führte, ganz zu schweigen von den grundlegenden Arbeiten zur metaphysischen Disputation, einem der Grundpfeiler des kulturellen Aufschwungs des Goldenen Zeitalters, das Europa mit Nachahmern spanischer Literatur wie Molière übersäte².
Wie Miguel de Unamuno treffend feststellte: „Es hat keinen Sinn, es immer wieder zu wenden, unsere Gabe ist vor allem eine literarische Gabe, und alles hier, selbst die Philosophie, wird zur Literatur... und wenn wir eine spanische Metaphysik haben, dann ist es die Mystik... ist das schlecht, ist das gut? Im Moment entscheide ich das nicht, ich sage nur, es ist so. ... und so wie es eine Differenzierung der geistigen Arbeit geben muss, wie der körperlichen, sowohl bei Völkern als auch bei Individuen, ist uns diese Aufgabe zugefallen.“³
In einem Land, in dem die Verfranzösischung eine nationale Institution ist, ist es natürlich bequem und verlockend, auf Max Webers Argumentation zurückzugreifen, wie sie in seiner „protestantischen Ethik und dem Geist des Kapitalismus“ dargelegt ist, und ohne großes Nachdenken die Lobgesänge auf die protestantische Ethik und die Förderung von Werten wie Selbstdisziplin, methodische Arbeit und rationale Vermögensbildung⁴ zu rezitieren – auch wenn, obwohl sie in Trient denselben Gott wie Spanien gewählt hatten, Venedig und Genua bereits im 12. bis 15. Jahrhundert fortschrittliche Finanzsysteme, internationale Handelsnetze und eine stark entwickelte Wirtschaftskultur besaßen, ebenso wie Florenz, Flandern, Bayern, das Rheinland und Baden-Württemberg.
Ein eigenes Kapitel verdient der Mythos der reformatorischen religiösen Toleranz, unter dessen Ägide in den lutherischen Gebieten des Heiligen Römischen Reichs das Prinzip cuius regio, eius religio eingeführt wurde, das es den deutschen Fürsten erlaubte, ihren Glauben allen Untertanen aufzuzwingen, wie es etwa in Sachsen und Hessen geschah, wo Katholiken nach der Konsolidierung des Luthertums verfolgt und ihre Kirchen geschlossen wurden; religiöse Orden wurden abgeschafft und Klöster konfisziert, um die politische und finanzielle Macht der lokalen Fürsten zu stärken.
Calvin wiederum errichtete ein System theologischer Überwachung, das sowohl liturgische Handlungen als auch die private Moral regelte, wobei doktrinäre Intoleranz und die Ausschaltung von Dissens die Norm in seiner theokratischen Republik waren⁵. Und was soll man von Oliver Cromwell sagen, dem englischen puritanischen Führer, unter dessen Protektorat die blutige religiöse Repression in Irland stattfand, wo die Besitztümer der irischen katholischen Kirche konfisziert, katholische Kirchen geschändet und geplündert wurden (mit einer Brutalität, die an die Vorgehensweise des Islamischen Staates in Palmyra erinnert).
Der puritanische Paroxysmus kulminierte in Massakern, die willkürliche Hinrichtungen von Katholiken einschlossen. Darüber hinaus schaffte sein Regime die Theater ab, führte rigorose Moralvorschriften ein und unterwarf das zivile Leben den Vorgaben der protestantischen Religion⁶.
Und doch war es gerade diese spezifische Form des Protestantismus, die letztlich ihre Mentalität weltweit durchsetzte: Nachdem sie 1608 in den Niederlanden Zuflucht gefunden hatten, weil sie in ihrer Heimat abgelehnt wurden, brach die radikalste Fraktion der englischen separatistischen Puritaner 1620 nach Nordamerika auf und ließ sich in Massachusetts nieder. Diese Siedler, und jene, die bald folgen sollten, waren nicht unbedingt die gebildetsten Europäer, wohl aber die kühnsten: radikal im Handeln mehr als im Nachdenken, verachteten sie die Vergangenheit und verehrten die Zukunft, sodass diese zeitliche Ausrichtung auf das Kommende allmählich zum Rückgrat des amerikanischen Nationalcharakters wurde.
Vertrauen in das Neue ist weniger eine individuelle Tugend als vielmehr Produkt sozialen Drucks: Der nordamerikanische Geist verlangt Enthusiasmus, Anpassungsfähigkeit und Optimismus und hat wenig übrig für Melancholie, Nostalgie und Introspektion, die im Ambiente europäischer Cafés stets gegenwärtig sind.
Dieser Optimismus kann jedoch religiöse Züge annehmen und Wirtschaft, Familie, soziale Riten und sogar den Sport mit fast sakraler Bedeutung aufladen: Er idealisiert mehr als dass er hinterfragt, schützt sich vor Zweifel durch funktionale Gewissheiten – ein Spiegelbild eines Charakters, der in der Weite einer rauen Landschaft geschmiedet wurde; so frei wie unsicher, wo der Amerikaner, losgelöst von europäischen Traditionen, seine Identität in einer physischen und moralischen Leere aufbaute. Diese Weite, geografisch wie moralisch, fördert Experimentierfreude und Pragmatismus, verlangt aber Handlung, um ihnen Sinn zu geben: Seine Massenkultur verachtet kontemplative Muße und gibt Nutzen, Geschwindigkeit und Wirkung den Vorzug.
Kunst und Denken werden so der Effizienz untergeordnet, und Idealismus, gemessen in quantifizierbaren Erfolgen, wird statistisch, was wiederum einen moralischen Materialismus hervorgebracht hat, der das Quantitative über das Qualitative stellt. Infolgedessen und mangels einer spekulativen Tradition ist in Nordamerika das Spirituelle funktional geworden⁷.
Als Tocqueville in den 1830er Jahren nach Amerika reiste, beobachtete er nicht nur ein neues politisches Experiment, sondern auch eine eigenwillige Spiritualität. Im Gegensatz zum europäischen Modell, in dem Religion mit politischer Macht verflochten oder Gegenstand von Säkularisierungskonflikten war, zeigt sich die Religion in den Vereinigten Staaten als autonome soziale Kraft, die das zivile Leben tiefgreifend beeinflusst. Tocqueville identifizierte fünf fundamentale Merkmale der Beziehung zwischen Religion und Demokratie in den Vereinigten Staaten: Erstens fungiert Religion – insbesondere in ihrer nüchternen, ethischen protestantischen Ausprägung – als moralische Grundlage der Freiheit, indem sie einen Rahmen bürgerlicher Tugenden bietet, der Selbstdisziplin stärkt und die Exzesse des liberalen Individualismus einschränkt; zweitens ermöglicht die Trennung von Kirche und Staat, ohne einen Bruch zwischen Religion und Gesellschaft zu erzeugen, dass der Glaube seine Vitalität bewahrt, ohne von der politischen Macht vereinnahmt zu werden; drittens fördern religiöser Pluralismus und Toleranz, anstatt den sozialen Körper zu zersplittern, einen stillschweigenden Konsens über die moralische Funktion der Religion; viertens verleiht spiritueller Pragmatismus, der auf das Alltagsleben ausgerichtet und von dogmatischen Streitigkeiten entfernt ist, der Religion einen funktionalen und praktischen Charakter; und schließlich das Gemeinschaftsengagement, bei dem Kirchen als soziale Akteure agieren, die ein gewisses Gleichgewicht zwischen individueller Freiheit, öffentlicher Moral und sozialem Zusammenhalt sicherstellen⁸.
Doch in jüngerer Zeit hat sich im amerikanischen evangelikalen Bereich ein totum revolutum herausgebildet, das sich in einer Form von theologisch-politischem Synkretismus manifestiert, die dispensationalistische Eschatologie, charismatischen Pfingstglauben und einen militanten christlichen Nationalismus vereint und eine religiöse Matrix schafft, die strukturell dem judenchristlichen Ebionitentum der ersten Jahrhunderte ähnelt – was eine Wende im amerikanischen religiösen Vorstellungsraum bedeutet und das tocquevillianische moralische Pragmatismus weitgehend durch eine Theologie apokalyptischer Erwartung ersetzt⁹.
Diese Konvergenz erzeugt eine zeitgenössische eschatologische Synthese, die die Geschichte als kosmischen Kampf zwischen Gut und Böse interpretiert, in dem bestimmte Nationen als bevorzugte Werkzeuge des göttlichen Willens angesehen werden. Ihr zentrales Element, der Dispensationalismus, wurde im 19. Jahrhundert von John Nelson Darby begründet und durch die Scofield Reference Bible weit verbreitet. Diese präsentiert eine wörtliche Bibelauslegung mit einseitigen Interpretationen, teilt die Geschichte in „Heilszeiten“ auf und weist dem ethnischen Israel eine zentrale Rolle bei der Vollendung der Zeiten zu, was einen bedingungslosen christlichen Zionismus und eine apokalyptische Sicht auf die internationale Politik rechtfertigt.
Das ursprünglich marginale und apolitische Pfingstlertum hat sich seinerseits zu Formen des nationalistischen Neopfingstlertums entwickelt, die Politik als Feld eines geistlichen Krieges betrachten und einen radikalen biblizistischen Literalismus und eine reaktionäre Moral vertreten⁹.
Diese Elemente fließen zusammen im christlichen Nationalismus, einer Doktrin, die die nationale Identität sakralisiert, die Unterordnung des Zivilrechts unter das „Gesetz Gottes“ fordert und bestimmten Nationen eine eschatologische Mission zuschreibt, die zur Führung des Kampfes gegen die Mächte des Bösen berufen sind und so eine angeblich verlorene moralische Ordnung wiederherstellen wollen. Diese theopolitische Konfiguration weist bemerkenswerte strukturelle Parallelen zum Ebionitentum des ersten bis vierten Jahrhunderts auf, etwa in der Zentralität eines wörtlichen Messianismus, der Normativität des religiösen Gesetzes, der Erwählung eines Volkes als Achse des göttlichen Plans, der Verschmelzung von Glaube und nationaler Identität und der Ablehnung pluralistischen Universalismus.
So teilen, obwohl durch Jahrhunderte und unterschiedliche doktrinäre Kontexte getrennt, das alte Ebionitentum und dieser zeitgenössische christliche Zionismus eine gemeinsame Logik: die Integration von Religion, Moral und Nation durch eine kämpferisch-providentialistische Eschatologie, die die Rolle des Glaubens im öffentlichen Raum tiefgreifend neu definiert und Sinn von Nation, Geschichte und Erlösung neu konfiguriert⁹.
All dies hat die amerikanische Spiritualität in einen globalen theopolitischen Rahmen eingefügt. Wenn Tocqueville die Fähigkeit der Religion bewunderte, den Materialismus einzudämmen, so neigen diese neuen evangelikalen Auslegungen dazu, den Glauben als Interpretationslinse der Weltgeopolitik zu verwenden und darüber hinaus religiöse Auswüchse wie die „Wohlstandstheologie“ des Pfingstlertums zu begünstigen, die die Rolle der Religion als Bremse des Materialismus umkehrt und Reichtum als Zeichen göttlichen Segens interpretiert¹⁰.
Die zeitgenössische nordamerikanische Spiritualität hat damit einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen, der letztlich eine Antwort auf die soziale, demografische und kulturelle Komplexität des heutigen Amerika ist: Urbanisierung, Migration, Globalisierung, Säkularisierung und politische Polarisierung. Spiritualität ist nicht mehr nur moralische Stütze der Demokratie, sondern ein symbolisches Schlachtfeld, auf dem um das Verständnis des Gemeinwohls, die nationale Identität und die politische Zukunft der Nation gerungen wird.
Wie wir im Falle des Konflikts Israel-Iran beobachten, können bestimmte biblische Deutungen und rhetorische Figuren (vgl. das Interview von Tucker Carlson mit Senator Ted Cruz vom 18. Juni 2025) als performative Kräfte in der internationalen Politik wirken. Es geht nicht nur darum, dass Gläubige auf die Erfüllung der Endzeit warten, sondern auch, dass sie aktiv so handeln können, dass sie sie herbeiführen oder beschleunigen. Das Eschaton, so verstanden, hört auf, eine prophetische Warnung zu sein, und wird zur geopolitischen Leitlinie.
Die dispensationalistische Theologie und ihre Ableger artikulieren eine eschatologische Sichtweise, in der der Konflikt zwischen Israel und Iran und der Wiederaufbau des Dritten Tempels grundlegende Elemente für die Vollendung des göttlichen Plans sind. Diese Weltanschauung, wenn sie zum Motor der Außen- und Verteidigungspolitik wird, schafft ein Szenario, in dem religiöse Überzeugungen direkt auf die zeitgenössische Geopolitik einwirken – was nicht nur weitreichende Folgen für die regionale und globale Stabilität hat, sondern auch den europäischen atlantistischen Voluntarismus seines Inhalts beraubt, den er zu anderen Zeiten haben mochte¹¹.
Fussnoten:
(1) Scruton, R. (2004). England and the need for nations. London: Civitas.
(2) Brufau Prats, R. (1992). La Escuela de Salamanca y el nacimiento del derecho internacional moderno. Ediciones Rialp.
(3) Unamuno, M. de. (1995). En torno al casticismo. Madrid: Espasa-Calpe.
(4) Weber, M. (2001). The Protestant ethic and the spirit of capitalism (T. Parsons, Trans.). London: Routledge. (Original work published 1905).
(5) Höpfl, H. (1982). The Christian polity of John Calvin. Cambridge: Cambridge University Press.
(6) Fraser, A. (2007). Cromwell: Our chief of men. London: Phoenix.
(7) Bellah, R. N. (1991). The broken covenant: American civil religion in time of trial (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
(8) Tocqueville, A. de (2008). La democracia en América (trad. J. A. González). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1835).
(9) Sutton, M. A. (2014). American apocalypse: A history of modern evangelicalism. Cambridge, MA: Harvard University Press.
(10) Bowler, K. (2013). Blessed: A history of the American prosperity gospel. Oxford: Oxford University Press.
(11) Gooren, H. (2010). Religious Conversion and Disaffiliation: Tracing Patterns of Change in Faith Practices. Palgrave Macmillan.