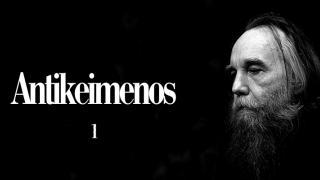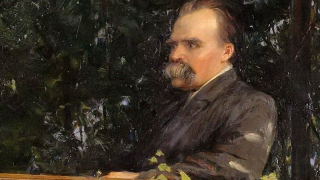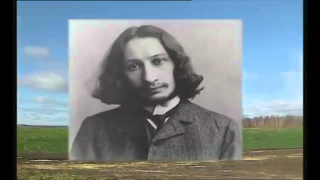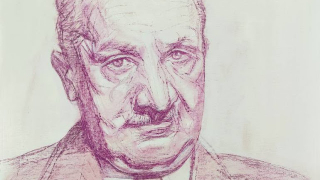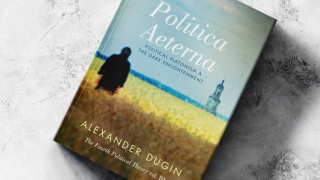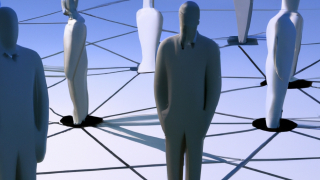Interview mit Stefan Blankertz Teil 4: Über Liberale, Anarchisten, Trumpisten, Aussteiger und den ganzen Rest.
Dugin beschrieb in "Die 4. politische Theorie und das Geschlecht", dass der Liberalismus, obwohl er sich rühmt, Theorie der Freiheit zu sein, auch ein Idealbild des guten Lebens hat (in dem Fall als unabhängige/r Geschäftsmann/-frau im Wettbewerb mit Anderen um Geld), was sich auch z.B. bei bestimmten Feministinnen zeigt. Und dass liberale Staaten auch bereit sind, ihre Mittel einzusetzen, um den Menschen zu diesem Ideal "hin zu erziehen". Während man andere Möglichkeiten wie z.B. Leben als Hausfrau oder asketischer Mönch eher vernachlässigt. Wie geht man mit diesem "subtilen Zwang" um?
SB: Wir müssen hier zwei Dinge klar auseinanderhalten. Auf der einen Seite gibt es rechte und linke Kulturkritiker, die bemängeln, dass die Menschen durch den Kapitalismus und seinen Reichtum dazu verführt werden, etwas zu tun, dass den jeweiligen Kritikern nicht schmeckt. Die Leute entscheiden sich anders. Sie hören nicht Klassik, sondern Pop. Die Frauen gehen lieber arbeiten, als von einem Ernährer abhängig zu sein. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass der Staat bestimmte Lebensstile propagiert oder subventioniert. Die Konservativen, die heute die angebliche oder wirkliche Propaganda gegen die Familie beklagen, hatten nichts dagegen, als der Staat die Familie hoch subventioniert hat. Zudem: Die Zeiten sind noch nicht allzu lange her, dass Ehemänner die Arbeitsverträge ihrer Frauen gegen deren Willen kündigen konnten. Und so weiter. Das ist natürlich falsch, egal, welchen Lebensstil der Staat propagiert oder zu verhindern trachtet. Beiden Fälle miteinander zu vermischen, ergibt dann keine sinnvolle Position mehr.
Laut Alexander Dugin war die Wahl Trumps eine Art inner-liberaler Bürgerkrieg. Man wollte die Linksliberalen vom Schlage eines George Soros, oder einer Hillary Clinton, die quasi den Liberalismus in sein krasses Gegenteil verkehrt haben, in ihre Schranken weisen. Der spätere Trump-Berater Michael Anton beschrieb das in seinem Artikel "The Flight 93 Election" ähnlich und sagte sinngemäß, selbst wenn man durch eine Wahl Trumps die USA zerstören würde, sei dies immer noch besser, als wenn diese Leute weiter die Macht haben. Wie denkst du darüber? Hatten die recht? Ist ihr Plan geglückt? Jetzt ist ja Joe Biden an der Macht. Falls er gescheitert ist, wie könnte man so etwas besser machen?
SB: Ich halte das für eine Mystifikation von Trump. Trump ist politics as usual. Carl Schmitt hat es richtig gesagt, aber die falschen Schlüsse daraus gezogen: Politik ist Verfeindungszwang. Ist Spaltung in zwei Lager. Die zwei Lager gehören aber stets zum selben System. Sie können aber die Anhänger nur mobilisieren, wenn sie ihnen erzählen, es ginge ums große Ganze, um Weltrettung. Das alles ist nur Schauspiel, darum war ja auch Ronald Reagan ein so begnadeter Präsident. Er war Profi. Das Volk muss abgelenkt werden, muss seinen Frust irgendwo ausagieren, am besten in der Unterstützung für einen Kandidaten, der dann voll in das System integriert wird. Die wirkliche Politik wird nicht von Verschwörern gemacht, weder rechten noch linken; der "deep state" ist keine Verschwörung. Die wirkliche Politik wird durch die systemimmanenten Notwendigkeiten bestimmt.
Zeitweilig in 2016 sah es so aus, als würde der Libertarismus untergehen und in Phänomenen wie der Alt Right, der Identitären Bewegung oder Konservatismus der Marke AfD aufgehen. Seit Corona scheint es aber auch für Libertäre eine Art "neuen Frühling" zu geben. Siehe die Trucker-Proteste in Canada. (Oder auch, dass Dugin öffentlich erklärt, dass er gewissen Respekt vor den Libertären hat. DAS hätte man ihm vor Jahren nicht zugetraut.) Siehst Du das ähnlich? Und falls ja, warum gewinnen Libertäre so sehr dazu? Und warum schwächeln gleichzeitig gerade Leute wie Götz Kubitchek in dieser Krise?
SB: Die Flüchtlingskrise konnte ziemlich leicht umgedeutet werden als eine Krise des zu schwachen Staats. Der Staat muss durchgreifen. Muss die Grenzen sichern. Muss die Kriminalität bekämpfen. Die Corona-Krise war für alle sichtbar die Krise eines Staats, der Amok läuft. Neben diesem aktuellen Grund ist aber das Wiedererstarken der libertären Idee auch ein Ergebnis dessen, dass wir eine viel gründlichere theoretische Arbeit geleistet haben, das libertäre Ideal philosophisch, psychologisch und soziologisch fundiert haben. Das trägt Früchte.
Peter Töpfer hat mich auch gebeten, nach einer Rechts- / Links-Spaltung innerhalb des Libertarismus zu fragen. Gibt es so eine Spaltung bei den Libertären? Wie sieht sie aus? Welche Seite ist die Bessere?
SB: Ja, leider ist die Rechts- / Links-Spaltung auch bei den Libertären zurückgekehrt, trotz des Slogans von Rothbard "jenseits von rechts und links". Rothbard hatte gesagt: Arbeitet mit jedem zusammen, der auch nur einen Zentimeter in Richtung Freiheit geht. Aber macht ihm klar, dass ihr weiter gehen wollte. Redet denen, mit denen ihr in einem Punkt zusammenarbeitet, nie nach dem Mund, um ihnen zu gefallen; macht die Unterschiede nie kleiner als sie sind. Das ist leider anders geworden. Nachdem die Kulturkonservativen die Macht an die etatistischen Linken abgeben mussten, haben sie die Staats- und Demokratiekritik entdeckt. Einige Libertäre sahen darin die Chance auf eine starke Koalition. Vorhin hatten wir die Schulfrage, das ist ein gutes Thema, um das Vorgehen deutlich zu machen: Weil die Linken in Deutschland die Einheitsschule, genannt Gesamtschule, durchsetzen wollen, klagen die Konservativen, sie würden den Staat benutzen, um ihre Ideen durchzusetzen und den Eltern das Selbstbestimmungsrecht zu nehmen. Dabei tun sie so, als sei das dreigliedrige Schulsystem, das es übrigens weltweit nur im deutschsprachigen Raum gibt, naturgegeben, als sei es aus freier Vereinbarung hervorgegangen. Aber das ist historisch falsch. Es ist ein Staatsschulsystem. Es wurde mit der Schulpflicht flankiert. Es herrschte staatlicher Lehrplan. Dieses Schulsystem definierte die staatlichen Standards, um am Berufsleben teilzunehmen. Die Rückkehr zum alten System ist nicht ein Millimeter in Richtung mehr Freiheit. Wenn ich bei den rechten libertären Genossen lese, wie wunderbar das bayerische Schulsystem sei, weil da mehr Leute durchs Abitur rasseln, sage ich innerlich: Genau, das ist Staatsterror. Der Staat maßt sich an, die Kinder in die Schule zu zwingen, dann ist die Schule so schlecht, dass sie die Prüfung nicht bestehen, und schließlich soll das dann das Gütekriterium der Schule sein. Keine Privatschule könnte existieren, deren Slogan lautet: Schickt eure Kinder zu uns, wir werden dafür sorgen, dass sie sich maximal unwohl fühlen, dass wie gebrochen und gedemütigt heraus kommen, und obendrein bestehen gute Chancen, dass wir sie zu Versagern erziehen. Nein, so etwas können wir staatliche Institutionen tun.
Dugin erwähnt in späteren Artikeln über dieses Phänomen des Linksliberalismus, dass auch Linksliberale anderer Länder Ideen haben, die extrem fragwürdig seien. Beispielsweise haben solche Leute in Russland mal gefordert, die Regierung durch eine Künstliche Intelligenz zu ersetzen. Das ist ja komplett undemokratisch und unliberal. Und man könnte sogar die böse Frage stellen, ob ein neuer Hitler, Calligula, Stalin oder Nero nicht im Vergleich zu 'nem Computerprogramm das kleinere Übel wäre. Denn mit einem Tyrannen könnte man wenigstens noch ansatzweise reden. Mit einem Großrechner nicht. Wie kommt es, dass liberale Politiker solche Forderungen stellen, die komplett ihren eigenen Prinzipien widersprechen?
SB: Konsequenz ist eine Tugend, aber sie ist leider wenig verbreitet. Und vielleicht kommt man, wenn man all die Dummhansel an der Regierung sieht, auf die Idee, ein Computerprogramm müsste das eigentlich alles besser können, weil es unbestechlich wäre. Aber ich kann der Idee nichts abgewinnen. Ob eine KI schlimmer wäre als die von dir Genannten, weiß ich nicht.
Dugin sagt in seinem Text "Die neue politische Anthropologie", dass der apathische Mensch, dem politische Dinge egal sind, nichts erreichen kann, um den Zusammenbruch aufzuhalten. Aber der sogenannte "politische Soldat", der sich einer Ideologie und/oder einer Partei verschreibt und dafür bereit ist, alles zu opfern, dieser kann ebenfalls rein gar nichts ausrichten. Wie siehst du das? Stimmt das?
SB: Das hört sich plausibel an. Der "apathische Mensch" allerdings, man könnte ihn mit Ernst Jünger "Anarch" nennen, ist allerdings bedeutend sympathischer. Er verweigert sich und tut wenigstens niemanden etwas zuleide. Wenn es viele ihm nachtäten, dann würde das System der Herrschaft in sich zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Aber natürlich, er tut nichts Aktives. Aber die Aktivisten, die gehen jedem auf den Sack.
Wir kennen dieses Phänomen, was Dugin beschreibt, ja auch. Politische Parteien wie die FDP waren eine ziemliche Katastrophe. Und die AfD ist eine Gruppe, wo Leute, die wirklich an was glauben, oft von Mitläufern, Bauernfängern und Pragmatikern an den Rand gedrängt werden. Die Piratenpartei hat sich erfolgreich selbst zerlegt. Was denkst Du über dieses Elend politischer Parteien? Bringt politische Parteiarbeit überhaupt irgendwas?
SB: Die Parteiarbeit hat ganz stark die Tendenz, in das bestehende System einzugliedern. Es ist eine Art der Selbstgleichschaltung. Wer eine Partei macht, muss sich an die Regeln der parlamentarischen Demokratie halten. Um Wahl zu gewinnen, muss man sich auf die Bauernfängerei einlassen. Schon lange, bevor man in die Nähe der Macht gelangt, wird einem die Staatsknete hinterhergeschmissen. Und wenn man dann tatsächlich in die Verlegenheit kommt, ein machtentscheidender Faktor zu sein, muss man als Partei irgendwie entscheiden – und jede Entscheidung ist falsch, weil jede Entscheidung sowohl über das Geld von Nichtzustimmenden verfügt als auch für Nichtzustimmende verbindlich ist.
Dugin beschreibt auch, dass der "politische Soldat" deshalb scheitern muss, weil er meist die Gegenwart nicht sieht, sondern in der Vergangenheit lebt, und deshalb auch seinen Feind nicht richtig erkennen kann, sondern einer Illusion nachhängt. Über die neue Linke mit ihrer Nazi-Paranoia haben wir schon geredet. Die Libertären sind aber oft genauso. Bei denen ist alles und jeder Sozialist und wir stehen kurz vor der Übernahme durch die "UdSSR". Während sowohl echte Nazis als auch echte beinharte Kommunisten heute eine Randerscheinung sind, die an Lächerlichkeit nicht zu überbieten ist. Wie geht man mit so etwas um? Und wie schützt man sich deiner Meinung nach vor solchem Irrglauben? Wie kann man es verhindern, zur Selbstparodie zu werden, die Phantomen nach rennt?
SB: Nur wer sich der Parolen verweigert, kann die Wirklichkeit sehen und analysieren. Die ganze Welt, die ganze Bandbreite der politischen Richtungen in Nazi/Nichtnazi oder in Sozialist/Nichtsozialist einzuteilen, ist wohlfeil und einfach, aber auch blöd und führt zu nichts.
Nach dieser Thematik des "politischen Soldaten" und dass dies momentan nicht sonderlich groß Sinn zu machen scheint, zu urteilen: In Deutschland scheint die rechte Metapolitik, wie sie insbesondere durch Götz Kubitcheks "Institut für Staatspolitik" betrieben wird, fast nur darauf abzuzielen, Wahlen für die AfD zu gewinnen und an politische Macht zu kommen. In Amerika hat Trump-Berater Michael Anton auch gesagt, man müsse, ins "Cockpit" der Nation eindringen und die Globalisten von der Macht entfernen. Nur haben wir eigentlich nicht eben "entdeckt", dass so ein Ansatz ziemlicher Schwachsinn ist? Und was wäre eine gescheite Alternative?
SB: Schwachsinn ist eine solche Strategie vom Standpunkt der Freiheit aus. Wer aber die Macht anstrebt, um daraus Vorteile und Gewinne zu ziehen, für den ist das genau die richtige Strategie. Ob Trump oder Kubitchek oder wer auch immer: Sie sind nicht daran interessiert, die Macht zu reduzieren; sie sind daran interessiert, sie ihren Feinden aus der Hand zu nehmen und selbst an sich zu reißen.
Kommen wir nun mal langsam weg vom liberalen Westen und hin zu Rothbard. Dazu hätte ich mal eine Frage erstmal. Dugin schrieb in seiner "Metaphysik des Chaos", dass das Chaos einmal nicht zur Untergang, sondern auch Möglichkeit zur Schöpfung bietet. Dann sagt Dugin etwas, was ich sehr interessant fand: Für die Zukunft sei das Chaos besser als Paradigma, als die Idee der Ordnung (und des zwanghaften Erhalts der alten Ordnung). Und zwar aus folgendem Grund: Eine Ordnung könnte keine alternative Ordnung neben sich oder ein Chaos in sich dulden. Das müsste alles ausgemerzt werden, um den Bestand der Ordnung zu sichern. Aus dem Chaos könnten aber ungehindert frei viele unterschiedliche Ordnungen entstehen. Wie würdest Du diesen Satz denken? Und kann man eine Verbindung zu Rothbards Idee der Privatrechtsordnung ziehen? Ich persönlich sehe starke Bezüge.
SB: Der Philosoph Salomo Friedlaender, der auch für die Gestalttherapie eine gewisse Bedeutung hat, hat von "schöpferischer Indifferenz" gesprochen: Sobald ich mich entschieden habe, ist es aus mit der Kreativität. Kreativ sein kann man nur an dem, was er Null-Punkt nannte, also solange man noch nach allen Seiten hin offen ist. Und sicherlich spielt das auch für Rothbard eine Rolle. Nur wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt, bleibt eine Organisation flexibel genug, um die Bedürfnisse ihrer Mitglieder zu erfüllen. Sobald sie zu sicher im Sattel sitzt, kann sie es sich leisten, gegen die Bedürfnisse zumindest eines Teils ihrer Mitglieder zu verstoßen. Und nur wenn diese dann die Möglichkeit haben, aus der Organisation auszutreten, kann das Leiden begrenzt werden. Natürlich erblicken die Ordnungs-Fanatikern darin nichts als Chaos.
Eine andere harte Überlegung. Stellen wir uns mal vor, der Traum der Rothbardianer geht in Erfüllung. Der Staat in seiner bisherigen Gestalt zerbricht. Wir haben kleine Stadtstaaten auf Basis von Rothbards Ideen. In gewisser Weise wäre das die Erfüllung und der Endpunkt der liberalen Theorie. Auf der anderen Seite gäbe es dann keinen Zwang mehr, liberal zu sein. Ein Dorf könnte liberal sein. Das Nachbardorf könnte 'ne Monarchie werden. Das andere Nachbardorf eine sozialistische Kommune im Stile eines Charles Fourier usw. Es gäbe keine "liberale Weltherrschaft", sondern eine Pluralität der Lebensstile und Gemeinschaften. Und es gäbe keinen omnipräsenten Machtanspruch der liberalen Theorie mit Menschenrechten, Demokratie etc. Könnte man also irgendwie sagen, dass wenn die Rothbardianer gewinnen würden, sich der Liberalismus "zu Tode siegen" würde? Und dass Rothbard die paradoxe Möglichkeit eröffnet, den Liberalismus zu "töten", indem man ihn bis zur Selbstabschaffung steigert? Wäre das ein Ansatzpunkt für einen liberalen Ansatz der 4. politischen Theorie? Ja. Wir wollen den Liberalismus beseitigen. Aber in dem Sinne, dass wir so frei werden, dass die Liberalen uns nicht beherrschen können?
SB: In meinem Buch "Anarchokapitalismus" habe ich geschrieben, dass die Form der Organisation völlig egal sei, solange sie freiwillig ist. Ob zentralistisch, autoritär, hierarchisch oder dezentral, demokratisch, egalitär. Ob Katholische Kirche oder Kongregationalisten, um das Spektrum im Christentum zu nehmen. Umgekehrt ist erzwungener Egalitarismus genauso falsch wie erzwungene Hierarchie. Ich sehe da aber keinen Gegensatz zum klassischen Liberalismus. Der klassische Liberalismus hat die Vertragsfreiheit in den Vordergrund gestellt. Eine Firma kann von einem Inhaber geführt werden oder genossenschaftlich. Ein Verein kann strikt hierarchisch sein oder demokratisch. Erst die Vermischung von Liberalismus mit Demokratie hat dazu geführt, dass etwa vorgeschrieben wird, wie Vereine oder sogar Firmen zu führen seien.
Kurz abgeleitet von diesen Überlegungen: Francis Parker Yockey sagte ja schon, dass Liberalismus eigentlich inkonsequent sei, und ein konsequenter Liberalismus nur ein Anarchismus wäre. Kann es sein, dass liberale Staaten eigentlich Inkonsequenz als wichtigstes Machtmittel nutzen? Beispielsweise das durch Yockey angesprochene Paradoxon "der Mensch ist nach den Liberalen schlau genug, um selber zu denken, braucht aber angeblich den Staat". Aber auch das Thema der oft durch liberalen Staaten genutzten Seeblockaden oder wie jetzt Wirtschaftssanktionen. Liberale fordern den freien Markt, aber sobald jemand aus der Reihe tanzt, schneidet man ihm von eben jenem freien Markt ab. Basiert die Macht liberaler Staaten also auf Inkonsequenz als Machtmittel?
SB: Die liberalen Staaten sind inkonsequent, ja. Aber ihre Macht beruht darauf, dass der Markt, auch der verstümmelte Markt, mehr produziert als eine stärker staatlich regulierte Wirtschaft. Der Staat kann also um so mehr durch Steuern und andere Mittel abschöpfen, je freier er die Wirtschaft lässt. Das ist das Macht-Paradox des liberalen Staats, aber auch seine Instabilität: Die Balance verändert sich immer mehr zugunsten des Staats und zuungunsten des Markts.
Wie würdest Du andere, nicht-liberale Anarchisten, oder auch Nationalbolschewisten oder uns hier, von Rothbards Ideen überzeugen?
SB: Ich versuche einfach, das darzustellen, was meine Gründe für meine Überzeugungen sind, und ich bin interessiert daran, warum Andere an anderen Überzeugungen festhalten. Wenn ein sachliches Gespräch zustande kommt, bin ich zufrieden. Wenn man nur versucht, den anderen auf Teufel komm heraus zu überzeugen, führt das zu nichts. Das Ziel sollte gegenseitige Achtung und Erkenntnisgewinn sein.
Einige Leute (zu denen ich gehöre) denken, ein real existierende Rothbardianismus würde einen hemmungslosen, rücksichtslosen Brachialindividualismus, wie es das Ideal so mancher Liberaler ist, gar nicht dulden können. Stattdessen würde es eher eine Form des Kommunitarismus werden und solche Egoisten müssten aufgrund des Überlebenswillens schnell ausgesondert werden. Wenn es eine so große Zahl an "Kleingruppen" mit begrenzter politischer Macht gäbe, wäre Gruppenloyalität nämlich überlebenswichtig. Wie siehst du das?
SB: Ja, natürlich. Ob Brachialindividualismus das Ideal mancher Liberaler ist, sei dahin gestellt. Rothbards Argument für den Markt lautete, er führe dahin, dass der am weitesten komme, der den Mitmenschen am effektivsten diene. Die Propagandistin des (philosophischen) Egoismus, Ayn Rand, hat ihn dafür scharf attackiert; sie sah darin eine Form von Lob des Altruismus.
Du hast mal erwähnt, dass Rothbard Überlegungen wie schwarze Sezession mit anschließendem eigenen kleinen "Ethnostaat" unterstützt hat. Kannst du darüber mehr erzählen?
SB: Eigentlich war das schon eine Idee von Thomas Jefferson. Sein Plan für die Sklavenbefreiung war, die Sklaven mit Land und Waffen auszustatten, damit sie dann frei entscheiden können, ob sie Teil der USA sein wollen oder was eigenes gründen. Rothbard hat sich in der Zeit, in der er die moderne libertäre Bewegung begründete, mit den Protesten der schwarzen Nachfahren der Sklaven Mitte der 1960er Jahre beschäftigt und gesagt: Die radikalsten von ihnen haben Recht, die nicht "Beteiligung" von dem System anstreben, das sie unterdrückt, sondern die komplette Abspaltung. Am Ende eines seiner Essays, in denen er diese Idee entwickelt, ruft er dazu auf, dass die alte amerikanische Recht und die Neue Linke ein Bündnis gegen den Staat schließen.
Anarchismus ist ja ein weites Feld. Und es gibt ja mehr als Rothbard und Hoppe. Welche anderen interessanten Ideen und Autoren aus der Richtung würdest Du empfehlen?
SB: Die klassischen Anarchisten wie Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin, Benjamin Tucker, Martin Buber sind besser als ihr Ruf. Ich habe gerade drei Essays von Proudhon gegen die militärische Herstellung des italienischen Einheitsstaats erstmals ins Deutsche übersetzt unter dem Titel "Für dezentrale Nationen". Sie sind einfach wunderbar.
Dugin hat Anarchismus vor einigen Jahren als eigentlich urchristliches (gnostisches) Prinzip beschrieben. Deine Meinung dazu?
SB: Wenn er damit auf Leo Tolstoi anspielt, hat er durchaus Recht. Andere Anarchisten waren dezidierte Atheisten wie Proudhon oder Bakunin. Bei Buber kann man schlecht von urchristlichem Ideal sprechen, sondern von einem urjüdischen, also einem Ideal, das vor der Staatswerdung Israels liegt. Buber meinte, das Königtum Gottes im Judentum bedeutete, dass eben kein Mensch König sein solle. Das, was ich unter Anarchismus verstehe, schließt durchaus jede Form von Gemeinschafts-Prinzip ein, aber ist sehr weit gefasst: Jeder möge nach seiner Façon selig werden.
Die Religionsphilosphin Savitri Devi beschrieb als einen Menschentyp den sogenannten "Menschen oberhalb der Zeit". Dies seien meist religiöse Menschen, die den Fall der Welt nicht mitmachen, die Gewalt und Materialismus ablehnen und sich deshalb in die Abgeschiedenheit zurück ziehen. Dies sei quasi die Weigerung, beim schlimmen Zustand der Welt mit zu machen. Man könnte es auch mit Christus sagen: Freund Gottes statt Freund der Welt sein. Ich hab erstaunlich viele libertäre erlebt, die diese Idee extrem anziehend fanden. Hast du eine Erklärung, wieso
SB: Ob nun religiöse Verweigerung, Ernst Jüngers konservativer "Waldgang" oder Herbert Marcuses "Große Verweigerung", Eskapismus hat Hochkonjunktur, wenn das herrschende System einerseits apokalyptische Strukturen annimmt, andererseits allzu fest im Sattel zu sitzen scheint. In seinem ersten Roman hat Paul Goodman eine Figur, die aus lauter Ekel vor der Welt nicht einmal mehr Brot essen will, weil es das bedeutet, der ganzen Maschinerie zuzustimmen. Goodman fand das nachvollziehbar, aber eben auch pathologisch. Sich aus der Welt zurückzuziehen, bedeutet eine Eigenschädigung, eine Selbstvernichtung: Damit erst dient man dem System.
Was denkst Du über religiöse "Aussteiger" wie die Amish oder die russischen Altgläubigen, die fernab der Gesellschaft in ihren eigenen Kommunen leben wollen? Kann man von denen etwas lernen?
SB: Sie haben das Recht dazu. Und ich bewundere ihre Konsequenz. Aber mich selber zieht dieses Lebenskonzept
Du hast früher oft den amerikanischen Paleokonservativismus gelobt, der momentan z.B. durch Nick Fuentes bekannt ist. Was ist an der Idee eigentlich so toll? Was kann man da lernen?
SB: Paul Goodman, der linke Anarchist und mein geistiger Übervater noch vor Rothbard, hat sich in einem seiner letzten Bücher als "neolithic conservative" bezeichnet. Das ist etwas anderes als der heutige "paleo conservatism". Soweit ich sehe, habe ich mit Nick Fuentes nichts gemeinsam, gar nichts. Goodman meinte mit seinem Begriff etwas ähnliches wie Martin Buber mit seinem Rückgriff auf die Sozialordnung der mittelalterlichen Stadt: Ein Zurückgehen auf eine Zeit, bevor der Staat die beherrschende Institution der menschlichen Gesellschaft wurde.
Als allerletzte Frage: Welche deiner eigenen Bücher würdest Du unseren Lesern besonders empfehlen? Und warum?
SB: "Rothbard denken": Ausgehend von Rothbard, aber auch über ihn hinaus, skizziere ich dort, wie stark der Staat unser Leben beherrscht. Es sind nicht mehr nur "Interventionen", die wie Nadelstiche ins Leben pieken, sondern er steckt mit seinen Infrastrukturentscheidungen das gesamte Feld ab, in dem wir uns bewegen. Entstaatlichung ist ein ziemlich radikales Projekt.