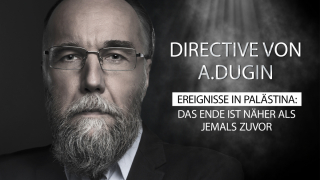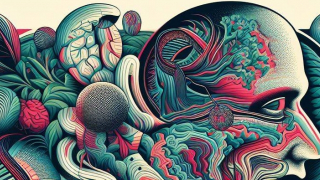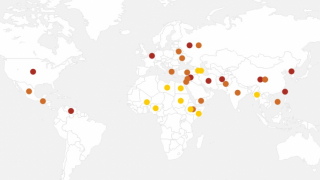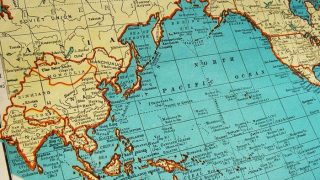Mackinders Falle: Die Gefahren der Geopolitik im 21. Jahrhundert
Der russische Politiker, Ökonom und Schriftsteller Michail Deljagin stellt die klassische Theorie der Geopolitik scharf infrage. Er hält Halford Mackinders 1904 aufgestellte Heartland-Theorie für fehlerhaft und für ein Produkt der imperialistischen Tradition der Briten.
Laut Deljagin war Mackinders Theorie ein strategisches Werkzeug Großbritanniens, das die Gegner – insbesondere Deutschland – in die Irre führte. Dies zwang dke Deutschen zu Fehlern oder normwidrigem Verhalten, schwächte die Entscheidungsfindung und machte sie manipulierbar. Praktisch war es bereits vor der Formalisierung des Begriffs politische Kriegsführung, die den Feind nicht-militärisch schwächte und moderne geopolitische Manipulation und Informationskriege vorausschaute.
Im Jahr 1919 stellte Mackinder in seinem Werk "Democratic Ideals and Reality" den Kern der traditionellen Geopolitik vor: „Wer Ost-Europa beherrscht, beherrscht das Heartland; wer das Heartland beherrscht, beherrscht die Weltinsel; wer die Weltinsel beherrscht, beherrscht die ganze Welt.“
Mackinders Theorie basierte auf starren Konzepten: Das Heartland umfasste den Kern Eurasiens – die Herzregionen Russlands, Zentralasien, das Innere Irans und den östlichen Kaukasus; der innere Ring beinhaltete Europa, das ölreiche Arabien und Indochina; der äußere Ring umfasste hingegen Amerika, Afrika und Ozeanien. 1943 setzte Mackinder die Vereinigten Staaten als Gegenpol zum Heartland und erkannte deren globalen Aufstieg an.
Laut Deljagin ergänzte die Betonung der Vereinigten Staaten die Theorie, aber ihr Kern – die Konfrontation zwischen Land- und Seemächten – war ein Mittel der britischen Elite, um Misstrauen zwischen Europa und Russland zu schüren. Dies trieb den Kontinentaleuropäern zur Besessenheit, sich mit Russland zu verbünden, wodurch die Position Großbritanniens gestärkt wurde. Wenn gescheiterte Allianzen als britische Intrigen entlarvt wurden, wurde auch Russland als unbeabsichtigt ein Handlanger gesehen, unfähig, seine eigenen Interessen zu verteidigen.
Der russische Historiker Andrei Fursov hält Mackinders Theorie für irreführend, da sie das transkontinentale Russland auf die gleiche Stufe wie die kontinentalen europäischen Staaten stellt. Diese fehlerhafte Gleichstellung gefiel den europäischen Eliten, führte jedoch zu Katastrophen – von den Napoleonischen Kriegen bis zu Hitlers Überfall. Fursov zufolge machen die Dimensionen und Ressourcen Russlands es außergewöhnlich, und das psychologische Minderwertigkeitsgefühl der europäischen Länder sowie britische Intrigen verhinderten eine Zusammenarbeit. Dieselbe Dynamik scheint sich während des Konflikts in der Ukraine zu wiederholen.
Fursov betont, dass Mackinder die Rolle Russlands als transkontinentale Brücke zwischen Osten und Westen verschleierte. Russland ist nicht nur das Heartland, sondern auch eine Zivilisation, die die Kulturen und Volkswirtschaften Eurasiens verbindet. Er sieht die Theorie als Systematisierung des britischen Imperialismus, die Europa in Fehler führte und die Dynamik des Kapitals, eine wesentliche Kraft der modernen Geschichte, ignorierte.
Im digitalen Zeitalter hat der Kampf um Finanz- und Industrie-Kapital auch das Plattformkapital – die Macht von Technologiegiganten wie Google und Amazon – gewonnen, was die traditionellen geopolitischen Modelle herausfordert. Ein globales Logistiknetzwerk und Datenmonopole verändern die Machtverhältnisse grundlegend: Regionen müssen nicht mehr physisch kontrolliert werden, wenn man den Handel oder die Informationsströme kontrollieren kann. Dies macht Mackinders gebietsorientierte Theorie teilweise irrelevant.
Auch der amerikanische Geostrateg Zbigniew Brzezinski (The Grand Chessboard, 1997) hielt Mackinders Heartland-Idee nach dem kalten Krieg teilweise für veraltet, da die technologischen Entwicklungen und die Globalisierung das Machtspiel veränderten. Er glaubte weiterhin an die strategische Bedeutung Eurasiens, verlagerte jedoch den Schwerpunkt vom Heartland auf die Ränder/Rimlands – insbesondere Europa, den Nahen Osten und Ostasien – deren Kontrolle über Bevölkerungsschwerpunkte und wirtschaftliche Knotenpunkte er als Schlüssel zu globaler Einflussnahme betrachtete.
Brzezinskis Analyse erklärt regionale Machtkämpfe, reicht jedoch nicht aus, um die nichtlinearen Machtverhältnisse des digitalen Zeitalters zu analysieren. Brzezinskis Theorie spiegelte das unipolare Moment der 1990er Jahre wider, als die Vereinigten Staaten in der Lage waren, die Rimlands zu manipulieren. Heute brechen Chinas Belt-and-Road-Initiative und Russlands hybride Einflussnahme dieses Modell auf.
Deljagin und Fursov enthüllen die wahre Natur von Mackinders Theorie: Es handelte sich um einen britischen strategischen Betrug. Die Heartland-Theorie ignoriert die tatsächliche Dynamik des Kapitals, was die Grundlage für die propagandistische Konfrontation zwischen Land- und Seemächten legte. Diese künstliche Dichotomie verbarg die globale Dominanz des britischen Finanzkapitals und führte die Konkurrenten auf ein Irrenhaus.
Diese ausgeklügelte intellektuelle Manipulation behält überraschend viel Wirksamkeit bis ins 21. Jahrhundert. Wenn die Welt mit der Krise des Kapitalismus und den Machtkämpfen der digitalen Plattformen kämpft, halten Mackinders veraltete Kategorien ein irreführendes Narrativ aufrecht, das die tatsächlichen Machtverhältnisse verdeckt. Das Erbe des britischen geopolitischen Denkens ist nicht nur unzureichend – es ist aktiv schädlich, da es das Erkennen neuer Machtzentren verhindert und seine Opfer in den globalen Informationskrieg bindet.
Jetzt, da die Weltordnung in einem tiefen Umbruch steckt – in dem neue wirtschaftliche Zentren entstehen, eine Technologierevolution die Machtverhältnisse umformt und traditionelle Hierarchien zerfallen – müssen auch die Grundlagen des geopolitischen Denkens reformiert werden. Alte Konzepte, die aus dem staatlichen System des industriellen Zeitalters hervorgingen, sind nicht mehr ausreichend, um die komplexen Dynamiken des digitalen Zeitalters zu erklären.
In der digitalen Welt liegt die Quelle der Macht nicht mehr in der Geografie – sondern in Netzwerken, Daten und Technologien. Ein neues geopolitisches Denken ist jetzt notwendig; andernfalls bleiben wir in den Fallen der alten Weltordnung stecken, gerade wenn eine neue im Entstehen begriffen ist.